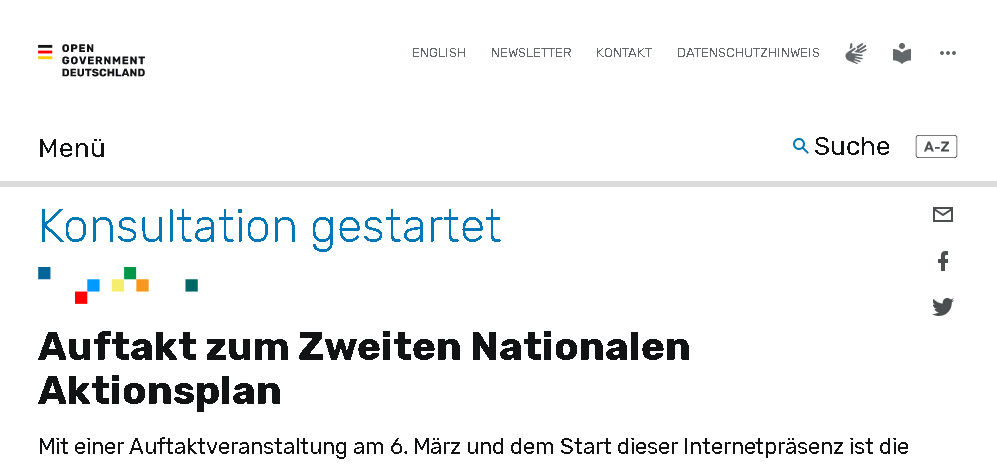Vor einem Jahr habe ich an einem Literaturwettbewerb zum Thema „unterwegs sein“ teilgenommen ohne irgendetwas gewonnen zu haben, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle den Beitrag für Euch, meine lieben Leser*innen veröffentlichen. Wer mich schon lange kennt, wird vielleicht einiges wiederfinden, das er oder sie schon einmal gelesen hat, aber trotzdem wünsche ich viel Spaß beim Lesen. Ansonsten schreibe ich derzeit mehr auf anotherworld.site, wo alle Leser*innen herzlich eingeladen sind, sich umzuschauen und den dortigen Blog zu abonnieren, liken und kommentieren…
Amélie hatte
ihre Leidenschaft zu ihrem Leben gemacht. Das Unterwegssein. Das Reisen. Sie
hatte sich nie Zuhause gefühlt, da wo sie aufgewachsen war. Wollte immer weg.
Schon immer. Und fuhr auch immer weg, wenn sie nur konnte. Bis ihr Leben sie
ganz ins Ausland führte. Auf andere Kontinente und dann irgendwann wieder
zurück nach Europa. Die letzten Jahre vor allem nach Frankreich. In das – für
sie – gelobte Land. Das, weil sie dort leben konnte wie sie wollte und das war
für sie das Wichtigste überhaupt.
„Un vrai
voyageur ne sait jamais où il va“ – „Ein wahrer Reisender weiß nie wohin er
reist“ – lautet ein arabisches Sprichwort. Das traf auch auf Amélie zu. Sie
wusste nie wirklich wohin sie reiste; sie hatte nur eine Ahnung. Denn sie ließ
sich führen auf ihrem Weg. Das heißt, meist wusste sie nur mehr oder weniger
wohin sie wollte und dann kam alles
anders. Pläne machte sie deshalb schon lange nicht mehr. Denn wenn sie
ausnahmsweise mal welche machte, dann
wurde sowieso alles kunterbunt durcheinandergeworfen. Deshalb hatte sie das
Pläneschmieden schon lange aufgegeben. Sie lebte einfach.
Und ganz
besonders, wenn sie mit ihrem Rucksack an der Straße stand, um zu trampen. Das
war immer ein ganz besonderer Augenblick. Das Gefühl des höchsten Glücks. So
hielten fast immer nette Menschen an, wenn sie trampte. Menschen, mit denen sie
sich sofort verstand. Denen sie etwas zu sagen hatte und die ihr etwas zu sagen
hatten. Die sie verstanden, auch wenn sie in einer vollkommen anderen
Lebenswirklichkeit lebten. Und so war es für Amélie eine Chance, von ihrem
Leben zu erzählen. Ihrem Leben fast ohne Geld. Denn seit vielen Jahren lebte
sie mit so wenig Geld wie möglich. Das war ihre Besonderheit. Und sie hatte darin
schon eine gewisse Perfektion erreicht.
Zum Beispiel, Menschen zu treffen, die sie bei sich einluden. So war sie
eigentlich immer eingeladen. Wenn die
Menschen sie mit ihrem Rucksack herumziehen sahen, fragten sie: „Wo schläfst du
heute Abend?“ Und Sie antwortete: „Ich weiß nicht.“ Und dann kam: „Du kannst
bei mir schlafen.“
Dann half
sie am Abend mit und am nächsten Morgen
wurde sie meistens eingeladen, länger zu bleiben. Da war sie glücklich. Es war
jedes Mal wie ein Geschenk, das aus dem Nichts kam. Sie hatte wieder einen
lieben Menschen gefunden, der sie eingeladen hatte. Noch dazu hatten sie einen
herrlichen Austausch, der ihrer beiden Herzen zum Hüpfen brachte. Der für sie
beide herzerwärmend war. Erheiternd. Eine Verbindung schaffend. Denn irgendwie
waren sie alle auf dem Weg.
Und da tat
es auch den anderen gut, einen Menschen wie
Amélie zu treffen, die mit leichtem Gepäck reiste. Die fast nichts
brauchte zum Leben. Und mit allem glücklich war. Deshalb liebte sie auch ihr Leben. Sie hatte
nämlich entdeckt, dass man umso glücklicher ist, je weniger man besitzt. Am
glücklichsten war man ganz ohne Geld. Ja, wirklich. Diese Erfahrung hatte
Amélie gemacht. Sie hatte nämlich ein Jahr lang ganz ohne Geld gelebt. Und das
war das glücklichste Jahr ihres Lebens. Denn sie hatte alles, was sie brauchte
umsonst bekommen, noch dazu ohne danach zu frag en. Ja umgekehrt: die Menschen
hatten sie gefragt, was sie denn brauchte.
Das war für sie alles so phantastisch gewesen, dass sie ihr Leben gar
nicht ändern wollte.
Kleidung
fand sie Zuhauf, zu Essen auch und wenn sie die Möglichkeit hatte, die Kleidung
irgendwo zu lagern, bot sie diese auf dem nächsten Flohmarkt mit den Worten
„alles umsonst“ an. Das brachte nämlich viel mehr, als sie zu verkaufen. Die
Leute freuten sich, denn sie konnten freiwillig geben, was sie wollten. Von
Herzen. Die meisten gaben für ein Kleidungsstück einen Euro. Amélie vertrat
damit ein Stück Gratiskultur. Und lernte wiederum nette Menschen
kennen, da wo sie gerade war. Bis sie immer mehr Ärger mit den
Flohmarktbetreibern bekam. Weil die Leute früh aufgestanden waren, um einen
guten Platz zu bekommen und stundenlang dagestanden hatten, um ihre Standgebühr
wieder reinzubekommen. Sie waren neidisch auf Amélie, weil sie spät gekommen war
und nichts für ihren Stand bezahlt hatte. Sie nahm ja auch nur ein paar Euro
ein, wie sollte sie davon eine Standgebühr bezahlen? Selbst darauf waren die
Leute neidisch. Dabei sollte es eigentlich auf jedem Flohmarkt einen Platz
geben, auf dem man Sachen umsonst abgeben kann ohne eine Standgebühr zu
entrichten. So fand Amélie jedenfalls. Auf manchen Märkten gab es das.
So reiste
Amélie und reiste. Aber sie besuchte in der Regel immer wieder die gleichen
Orte. Sie hatte ihre Routen. Bestimmte Achsen, auf denen sie sich bewegte. Und
Freundinnen und Freunde, die sie immer
wieder besuchte. Mal in Städten, mal auf dem Land. Das Reisen, das
Unterwegssein war für sie das höchste Glück. Sie liebte es frei zu sein,
ungebunden, ungezwungen, in der Natur sein zu können, zu machen, was sie
wollte, zu lieben, was ist und die Menschen, die sie traf zu nehmen wie sie
sind.
In
Frankreich ließ sich so gut leben. Immer wenn Amélie anderen von ihrem Leben
erzählte, waren die Menschen so begeistert, dass sie gar nicht verstanden,
warum sie meinte, sie müsse ihr Leben
ändern. Das meinte sie auch nicht wirklich, weil sie ja so glücklich war, dass
sie sich gar kein anderes Leben vorstellen konnte. Aber manchmal fand sie doch allzu viele
„change-Botschaften“ auf der Straße. Bei einem ihrer Freunde hing „Change“ in
großen Lettern auf einer Plakatwand, auf der sie beim Frühstück blickte. Doch
was sollte sie nur verändern? Sie hatte absolut keine Idee. Sie fühlte sich wie Alice im Wunderland. Alles kam auf absolut
phantastische Art und Weise zu ihr, sie war immer bei Leuten und nicht allein,
es gab einen regen Austausch, was wollte sie mehr? Sie brauchte doch gar nicht
mehr.
“Ich habe
alles, was ich brauche und was ich nicht habe, brauche ich nicht“, war eine
ihrer Devisen. Ihr fehlte nur eins: eine Gemeinschaft. Und die Möglichkeit,
etwas aufzubauen. Denn so wie es war merkte sie nach geraumer Zeit, war sie
immer auf dem Nullpunkt. Fing immer überall bei null an. Wenn sie wiederkam
nach einem Jahr zu ihren altbekannten Freunden, war fast nichts mehr da von den
Sachen, die sie das letzte Mal zurückgelassen hatte. Langsam nach so vielen
Jahren des Herumziehens wurde Amélie ein wenig müde. Genauso wie sie nach einem
Jahr des Lebens ohne Geld müde geworden war und ausgelaugt, denn es war doch
ein anstrengendes Leben gewesen. Und: wenn sie ein Jahr Revue passieren ließ,
da stellte sie fest, dass sie sich nur im Kreis gedreht hatte.
Und als sie
gerade in einer Phase des Zweifels war über das, was sie machen sollte, jetzt
eine Weltreise oder sich endlich mal wieder eine Basis zulegen, da traf sie
eine Bekannte, die ihr von Jehuda Amichai und seinem Buch „Nicht von jetzt,
nicht von hier“ erzählte.
„Darin
wusste die Hauptperson Joel nicht, ob er nach Würzburg reisen sollte, wo er
geboren war, – er nennt es in seinem Roman Weinburg – oder ob er in Jerusalem
bleiben sollte. Er konnte sich nicht entscheiden. Und in seinem Buch geht es
darum, dass er sich nicht entscheiden muss zwischen ‚entweder/oder‘, sondern
dass er ‚sowohl als auch‘ das eine wie das andere machen kann.“
Amélie war
ganz geplättet. ‚Sowohl als auch‘ statt ‚entweder/oder‘ das stand für sie,
nachdem sie letzthin ein Video über die „verbotenen Früchte des Garten Eden“
eines Schweizer Forschers gesehen hatte, für den biblischen Gott. Denjenigen,
an den Jehuda Amichai wohl geglaubt hatte und wegen dem er in diesem Land, in
dem sie gerade waren, damals verfolgt worden war.
Und so kam
sie nach ganz vielen Jahren des Unterwegsseins endlich zu dem Entschluss, sich
wieder ein Basislager zuzulegen. Und
zwar hier. Hier in dieser Stadt. Weil sie sich hier Zuhause fühlte. Auch weil
ihr eine liebe Freundin aus Spanien immer wieder dazu geraten hatte. Sie selbst
sah dafür eigentlich gar keine Notwendigkeit. Auch die Germanen waren Nomaden gewesen.
Und Abraham war ein Wanderer. Wie auch sie. Denn wenn sie unterwegs war, war
sie gesund. Das Reisen war ihr bestes Heilmittel. Und: der Versuch, aus jedem
Tag ein sich selbst kreierendes Kunstwerk voller Abenteuer zu machen, denn
„Ein Tag ohne Abenteuer ist kein
Tag“.